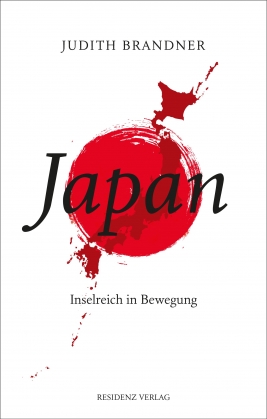Highlights
27. April 2020
Judith Brandner, Königstetten
An meiner Schreibtischlampe hängen zwei O-mamori. Immer, wenn ich hier sitze – also täglich –, sehe ich sie vor mir baumeln. Und immer, wenn mein Blick darauf fällt, geht mir das Herz auf. Es sind kleine Säckchen aus orangefarbener bzw. grauer Seide mit goldenen Schriftzeichen und Ornamenten, verschlossen mit einem weißen, zu einer Masche gebundenen Bändchen. Ich habe sie vor langer Zeit von lieben Menschen in Japan bekommen, die mir auf diese Weise ihre Gefühle und ihre Wertschätzung ausgedrückt haben. Was in diesen Beutelchen drin ist, bleibt ein Geheimnis, denn man darf sie nicht öffnen. Auf jeden Fall ist es etwas Gutes, glückbringende Wünsche für Erfolg in Beruf oder Studium, sichere Geburt, Schutz im Straßenverkehr. Die schützende Hand der Götter. Und nun also auch der Schutz vor Corona. O-mamori sind, so höre ich, in Japan dieser Tage gefragter denn je. Am O-mamori zeigt sich der japanische Synkretismus: Sowohl Shinto-Schreine als auch buddhistische Tempel verkaufen die Talismane. Eigentlich sollte man sie ein Jahr nach Erwerb oder Erhalt verbrennen, und neue kaufen. Meine hängen seit Jahren da und sie schützen mich noch immer. Es geht mir doch gut, inmitten dieses globalen Experiments, von dem wir noch nicht wissen, wohin es uns führt, und wofür es dient.
Und schon erzeugt die Angst vor der unsichtbaren Gefahr eine Kluft zwischen den einen, die den offiziellen Verlautbarungen blind vertrauen, und den anderen, die ihre Zweifel daran haben und kundtun. Schon vernadern die einen die anderen. Schon gibt es Streitgespräche in den eigenen Familien über das, was zu tun und zu lassen ist. Wir sind Laien auf dem Gebiet der Medizin und der Virologie. Wir sind Laien auf dem Gebiet der Radioaktivität. Wir müssen uns an die Expert*innen halten. Die Parallelen sind unübersehbar: Aus noch zu analysierenden Gründen tendieren wir zu den einen oder anderen Expert*innen. Die Corona-Angst ist schlimmer als das Virus selbst, hat der Chef der Luxus-Elektroautofirma gemeint. Die Angst vor der Radioaktivität ist schlimmer als die Strahlung selbst, hat ein hochrangiger Arzt in Japan Bedenken zu zerstreuen versucht. Vielleicht ist ja das Spiel mit der Angst ein Teil des Experiments.
19. April 2020
Judith Brandner, Königstetten
Der heimische „Epidemiebote“ hält sich an die Osterruhe. Keine neuen Verordnungen. „Der Epidemiebote hat sich die Aufgabe gestellt, unsere Mitbürger mit gewissenhafter Unabhängigkeit über die Fortschritte oder das Nachlassen der Krankheit zu unterrichten; ihnen die berufensten Ansichten über die Zukunft mitzuteilen; allen Bekannten oder Unbekannten, die die Geißel bekämpfen wollen, die Unterstützung seiner Spalten zu gewähren; den inneren Halt der Bevölkerung zu kräftigen, die Anweisungen der Behörden bekanntzugeben; mit einem Wort, alle diejenigen, die guten Willens sind, zu sammeln, um wirksam gegen das Unglück, das uns trifft, zu kämpfen.“ (Albert Camus).
Japans „Epidemiebote“ sitzt auf einem eleganten Sofa, ein Tässchen Tee in der Hand, einen süßen schwarzen Hund auf dem Schoß, und fordert die Bevölkerung auf, von nun an zu Hause zu bleiben. Das Setting kam gar nicht gut. „Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind?!“, richtete einer dem japanischen Ministerpräsidenten via Twitter aus, bar jeder höflichen Zurückhaltung, „Wir versuchen zu überleben, und Sie zeigen uns dieses Video von Ihrem Luxusleben!“ Schon hatte ich geglaubt, dass die japanische Höflichkeit und Etikette mit ihrem kulturell verwurzelten Abstandhalten und Maskentragen das Inselreich von Corona weitgehend verschont habe. War doch dort das kollektive und feucht-fröhliche hanami, das Bestaunen der Kirschblüte, noch zu einem Zeitpunkt möglich, als wir hier das Haus längst nur mehr in den erlaubten seltenen Fällen verließen. Einzeln. Maximal zu zweit. Dann hatte Abe Ende März an die Menschen in Tokyo, Osaka und anderen Großstädten appelliert, doch dieses Wochenende mal freiwillig zu Hause zu bleiben. „Wir machen dieses Wochenende social distancing“, ulkte eine Freundin. Eine Woche zuvor war die Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokyo wegen der weltweiten COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Und nun steigen auch in Japan die Fälle, wird das öffentliche Leben nach und nach heruntergefahren. Ist über vorerst sieben Präfekturen der Ausnahmezustand verhängt worden. Die Universität meiner ehemaligen Studentin Yui hat bis September Online-Unterricht verordnet. Yui schickt mir eine Liste mit Vorschriften, an die sie sich halten muss. Alle Studierenden sind angehalten, nicht auszugehen und keine Reisen zu unternehmen, außer in unbedingt notwendigen und dringenden Fällen. Gehört unser Hiroshima-Projekt dazu? Aus der Sicht der japanischen Behörden wohl eher nicht. Mit Yui als einer meiner wichtigsten Protagonistinnen wollte ich einen Film zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima drehen. Es sollte eine Spurensuche mit der Enkelgeneration werden. Yuis Großvater war ein hibakusha, ein Überlebender der Atombombe. Sie hat seine Geschichte aufgearbeitet und niedergeschrieben, und arbeitet nun an ihrer Dissertation über die Traumatisierung von Atombombenüberlebenden. Es wird ein Pionierwerk werden, denn darüber hat in Japan bislang noch niemand geforscht.
Der Chef der japanischen SoftBank Gruppe, Masayoshi Son, hat unterdessen einen Deal mit dem chinesischen Elektroautohersteller BYD geschlossen, der auf Maskenproduktion umgestellt hat. Der Kommunikations- und Medienkonzern SoftBank kauft von BYD 300 Millionen Gesichtsmasken pro Monat. SoftBank gibt sie an die Japaner*innen weiter, ohne Profit dabei zu machen, wie Son betont. Und die Regierung Abe lässt zwei waschbare Masken pro Person über das Verteilsystem der japanischen Post an die Haushalte liefern.
Japan habe die tatsächlichen Zahlen der Corona-Erkrankungen verschleiert und Maßnahmen verzögert, um die Austragung der Olympischen Spiele nicht zu gefährden, meinen böse Zungen. Erst seit klar ist, dass es heuer keine Spiele gibt, sammelt auch in Japan der Epidemiebote „alle diejenigen, die guten Willens sind, um wirksam gegen das Unglück, das uns trifft, zu kämpfen.“
5. April 2020
Judith Brandner, Königstetten
Freund Ogino darf seine 98jährige Mutter nicht mehr besuchen. Er gibt bei der Rezeption des Altersheimes eine Portion Eiscreme für sie ab. Sie lebt auf der Demenzstation. Ihren Sohn erkennt sie schon lange nicht mehr. Ihre Leidenschaft für Eiscreme ist geblieben. Ogino ist nach Kyoto gekommen, um im Krankenhaus nach einer Knieoperation die Schrauben herausnehmen zu lassen. Ansonsten lebt er in Thailand. Jetzt aber hat Thailand die Grenzen dichtgemacht und lässt ihn nicht mehr zurückreisen. Sho ga nai, sagt er schicksalsergeben. Da kann man nichts machen.
Ein Farbholzschnitt von Tsukioka Yoshitoshi aus dem Jahr 1891 zeigt einen Mann, der seine alte Mutter auf dem Rücken einen Berg hinaufträgt. Es ist der Berg obasuteyama in der Präfektur Nagano, übersetzt „der Berg, auf dem die alte Oma weggeworfen wird“. Obasuteru, also die Oma entsorgen, bezeichnet den Brauch, die eigene Mutter auf den Berg zu tragen, dort auszusetzen und sie dem Hungertod zu überlassen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hat. Es ist eine alte japanische Legende, die in mehreren Varianten und immer wieder neu erzählt wird. Eine davon ist die Geschichte, dass die alte Mutter, während der Sohn sie auf dem Rücken hinaufträgt, die überhängenden Äste der Bäume erhascht und abknickt. Als sie oben angelangt sind, fragt der Sohn, warum sie das gemacht hat. „Damit du dich beim Zurückgehen nicht verirrst, mein Sohn!“, antwortet die Mutter. Da weinte er bitterlich und nahm sie wieder mit hinunter.
Im Elsass, so hört man in diesen Tagen, werden Patient*innen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen ab einem gewissen Alter nicht mehr beatmet. Sie bekommen eine Überdosis Schmerz- oder Schlafmittel.
28. März 2020
Judith Brandner, Königstetten
Ich möchte nur schlafen. Neulich waren es 12 Stunden am Stück. Vielleicht sollte man diese Krise einfach verschlafen. Der Schlaf ist nicht erquickend. Eine bleierne Müdigkeit lähmt mich tagsüber. Die Zeit verrinnt. Ständig das Gefühl, etwas versäumt zu haben. Nicht rasch genug auf die letzten Nachrichten reagiert zu haben. Auch die Katzen schlafen jetzt noch mehr als sonst. Sie machen nur kurze Spaziergänge. Alleine. Suchen unsere Nähe. Schlafen in unserem Bett. Kuscheln sich an uns. Normalerweise genieße ich die Stille in meinem Büro daheim, mit dem einzigartigen Blick auf den Garten und den Teich. In diesen Tagen ist sie mir zu laut.
Die Olympischen Spiele in Tokyo sind um ein Jahr verschoben worden. Auf 2021, das Jahr, in dem sich auch die Dreifachkatastrophe mit dem Super-GAU in Fukushima zum zehnten Male jährt. Schon bald, Ende Juni, wartet ein Kamerateam in Hiroshima auf mich. Bis dahin bin ich sicher wieder aufgewacht.
26. März 2020
Judith Brandner, Königstetten
Es ist uns einfach so lang so gut gegangen. Zu gut gegangen. Sagt meine Mutter, mit der Betonung auf ZU. Sie lebt in Salzburg, ich in Niederösterreich. Ich rufe sie in diesen Tagen öfter an als vorher. Nicht mehr nur am Samstag. Ihr Leben hat sich wenig verändert. Die Heimhelfer*innen tragen jetzt Schutzkleidung. Der Zusteller von „Essen auf Rädern“ hält Abstand und nimmt kein Bargeld mehr. Der Fußpflegetermin ist abgesagt worden. Mutter klingt jetzt fröhlicher als vorher. So viele Nachbar*innen haben ihr ihre Hilfe angeboten! Der Bundespräsident hat so schön und respektvoll von den alten Menschen gesprochen! Auch der Bundeskanzler mache sich sehr gut, findet sie. Mit meinen Schwestern tausche ich Blumenbilder via WhatsApp aus. Ich beginne den Tag mit einem Foto von der eben aufgeblühten rosa-weißen Kamelie im Garten. Die Jüngere, im hunderte Kilometer entfernten Home-Office in Deutschland, möchte gerne bald telefonieren. Sie fühle sich ein wenig isoliert. Sie darf nicht mehr nach Österreich einreisen.
Japan ersucht alle Reisenden aus Europa, Ägypten und dem Iran, sich 14 Tage unter Selbst-Quarantäne zu stellen. Die ersten findigen Hotelbesitzer bieten günstige Zimmer an. Wer will jetzt ausgerechnet nach Japan?! Mein Ticket nach Tokyo für Juni habe ich vorsorglich schon lange davor gebucht. Weil doch zu erwarten war, dass die Preise rund um die Olympischen Spiele in die Höhe schnellen würden. Auch mein Lieblingshotel in Tokyo ist vorreserviert. Und nun gibt es diesen neuen, unsichtbaren Feind, der sich ausbreitet. Ich denke an Fukushima. An die Menschen, die sich an das Leben mit einer unsichtbaren Gefahr gewöhnt haben. Oder davor geflüchtet sind. Vor Corona kann jetzt keiner mehr flüchten. Geschlossene Geschäfte, leere Plätze. Menschen mit Masken. Die Aufforderung, daheim zu bleiben und Kontakte zu meiden. Im dekontaminierten Fukushima immer noch Hot-Spots, nach neun Jahren. Da ein Atomkraftwerk, das in die Luft geflogen ist und winzige radioaktive Partikel ausgestreut hat. Dort ein Virus, das sich in feinen Aerosolen über uns breitet und in uns eindringt. Man sieht es nicht, man hört es nicht, man riecht es nicht. Die Radioaktivität ist nicht übertragbar. Man-made disaster, in beiden Fällen. Wildtiere am Speiseplan in der chinesischen Provinz, Ballermann und Komasaufen in den Tiroler Bergen. Keine Naturkatastrophen. Ich esse keine Tiere. Die, die mit uns leben, sind mir jetzt wichtiger denn je.
Die gute Nachricht kommt am späten Nachmittag. Endlich ruft E. an. Er und seine Frau R. haben seit vier Jahren auf einen Asylbescheid gewartet. Jetzt ist er da. Positiv. Eine Sorge fällt weg. Bald wird R. ihr zweites Kind bekommen. E. und R. haben die letzten Monate fast durchgehend im St. Anna Kinderspital verbracht. Ihr dreijähriger Sohn wartet auf eine Knochenmarktransplantation. Er hat Leukämie.
Schriftsteller-Freund*innen schicken mir Texte und Links zu ihren YouTube-Auftritten. Die älteste von ihnen, Jahrgang 1923, telefoniert lieber. Sie fühle sich an das Frühjahr 1945 erinnert, kurz nach der Befreiung, an die Unsicherheit über die Frage, wie es weitergehe würde. Der Antrag meiner Mutter auf Erhöhung der Pflegestufe ist abgelehnt worden. Es fehlen vier Stunden Pflegedarf. In einem Jahr darf sie, die heuer 83 geworden ist, einen neuerlichen Antrag stellen. Sie nimmt es mit erstaunlicher Gelassenheit.