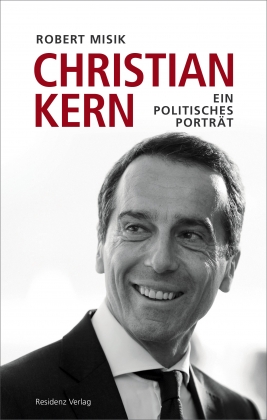Highlights
26. März 2020
Robert Misik, Wien
Die pandemische Gesellschaft
Einen schönen Tag aus dem Hausarrest, oder wie man heute sagt, dem Home-Office, ich möchte Ihnen ein wenig erzählen, was mir so durch den Kopf geht, extrem subjektiv, klar, alles ist immer subjektiv, aber das Subjektive ist jetzt noch subjektiver, weil man anderen Leuten, Leuten, in die man sich einfühlen könnte, ja nicht einmal begegnet, heutzutage. Wir sollen ja soziale Distanz halten. Und in einer solchen Situation ist die Subjektivität noch subjektiver, als sie sowieso immer ist, hab ich das Gefühl.
Zwei Wochen ist es jetzt her, dass die ersten Notstandsmaßnahmen verhängt wurden, und mehr als eine Woche, dass die massiven Einschränkungen in Kraft traten. Und es ist ein schleichender Vorgang, weil wir alle ja erst nach und nach begreifen, in welcher Lage wir sind, was da möglicherweise auf uns zukommt, eine "Naturkatastrophe in Zeitlupe" hat das dieser Popstar unter den deutschen Virologen genannt, und das ist es ja auch irgendwie, wir sehen eine Lawine, aber sie kommt sehr langsam auf uns zu. Und das führt zu einer eigentümlichen kognitiven Dissonanz zwischen dem Gefühl der Katastrophe und dem Gefühl der Normalität, denn wir leben zwar nicht unseren normalen Alltag, aber wir sind natürlich nicht mit einer Katastrophe konfrontiert, nicht mit Sterbenden, die meisten von uns nicht einmal mit Kranken, viele kennen nicht einmal eine Person, die mit Corona infiziert ist.
Die Geschichte der Epidemien lehrt uns auch, - ich lese jetzt dauernd, wenn ich mich entspannen will, die Geschichte der Epidemien, Weltgeschichte von Pest, Pocken, Cholera und Spanischer Grippe. Um mich von den aktuellen Nachrichten abzulenken, mich aber zugleich nicht zu einem völlig abwegigen Thema zwingen zu müssen, lese ich die Weltgeschichte der Epidemien - also, was ich sagen wollte, die Weltgeschichte der Epidemien lehrt uns auch, dass sie langfristige Mentalitätsveränderungen bringen können. Wussten Sie, dass das Schönheitsideal des dürren, blassen, durchsichtigen Models direkt aus der Tuberkulose-Epidemie kam, weil die auch die Reichen, die Jungen, die Künstler, die Intellektuellen traf, und diese zwar hinraffte, aber sie, anders als etwa die Pocken, nicht entstellte? Ohne Tuberkulose sähen unsere Modezeitschriften heute anders aus, aber bitte, ich schweife ab....
Epidemien können Gesellschaften verrohen, aber auch der Wissenschaft zum Durchbruch verhelfen, manchmal sogar beides gleichzeitig. Während der Pestepidemien, besonders in den ersten Wellen, da war das noch so, dass viele dachten, die Pest sei von Gott geschickt, eine Strafe für die Sünder. Und es gab auch Gemetzel, man dachte, Minderheiten hätten sie eingeschleppt, und diese Minderheiten wurden dann Opfer von Pogromen. Und selbst wenn es nicht so arg kam, haben Pandemien oft zu religiöser Rigidität, zu Frömmlertum geführt. Aber zugleich auch zum Durchbruch von Wissenschaftlichkeit, zu modernen Hygienestandards, weil es auch Mediziner und auch Regierende gab, die verstanden haben, dass das eine Krankheit ist, die biologische Ursachen hat, und dass da kein Gott beteiligt ist.
"Epidemics kill Compassion, Too", hat ein Kolumnist in der New York Times geschrieben, weil wir natürlich zwar Mitgefühl mit unseren Nächsten, mit den Opfern einer Pandemie haben, wir aber auch aufs eigene Überleben schauen, und wenn wir aufs eigene Überleben schauen, dann ist der Nächste, der Nachbar, der Passant, der uns zu nahe kommt, in einer Pandemie eine tödliche Gefahr. Gewiss leben wir nicht in so finsteren Zeiten wie damals, als man die Kranken in den Straßen liegen ließ und versuchte, das Weite zu suchen, doch es braucht nur einer neben dir zu husten und schon wird Mitgefühl ein wenig überlagert durch den Instinkt: "Nix wie weg". Manche Katastrophen sind Motoren von Solidarität, Erdbeben etwa, da kann man Obdachlose bei sich aufnehmen oder Verschüttete gemeinsam ausgraben, aber manche Katastrophen sind eher keine Schule der Solidarität, und Epidemien gehören sicherlich dazu.
Pandemien können daher einen Schleier wegziehen, einen Vorhang vor liebgewonnenen scheinbaren Gewissheiten, und uns etwas über uns sagen, über unsere Nächsten, etwas, was wir gar nicht so genau wissen wollten, womöglich. Und über unsere Gesellschaft. Was wir auch lernen: Wir alle hängen zusammen. Man kann sich nicht gut alleine retten. Also nicht auf Dauer. Auch der Stärkste kann nur dann gut leben, wenn auch der Schwächste sicher ist. Das hat in der Geschichte auch zu hygienischen Wohnungen, zu kulturellen Fortschritt, zu ordentlicher Wasser- und Abwasserversorgung, zu einem Gesundheitssystem für alle geführt, weil Pandemien klar machen, wenn das Gesundheitssystem NUR für die Reichen funktioniert, dann funktioniert es für niemanden, nicht einmal für die Reichen. Das ist durchaus eine gute Nebenfolge von Pandemien.
Zugleich führen Pandemien zu autoritären Versuchungen der Herrschenden, weil mit Hinweis auf die medizinische Lage Notmaßnahmen und diktatorische Anordnungen gesellschaftliche Zustimmung finden, die sonst nie Zustimmung fänden, und wie die Herrschenden so sind, sie haben es hinterher selten eilig, diese diktatorischen Vollmachten wieder abzugeben. Was wir aber zugleich auch lernen, nur so als ein Beispiel, ist, dass diese Vorstellung, und wir hatten sie doch irgendwie alle, diese Vorstellung, dass moderne Gesellschaften stabil sind, dass sie Sicherheit und Kontrolle bewahren, auf sehr wackeligen Beinen steht. Gewiss wussten wir, dass jeder einzelne von uns in schwierige Situationen kommen könnte, dass wir ins Elend rutschen könnten, dass wir krank werden könnten, dass wir einen Unfall haben könnten, aber die allermeisten von uns sind intuitiv doch immer davon ausgegangen, dass die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen die Kontrolle bewahren, es gab da schon so ein grundlegendes Sicherheitsgefühl, von der Art: Überfährt mich ein Auto, kann ich mich wenigstens auf beste Versorgung und eingespielte Abläufe verlassen. Chaotischen, gesellschaftlichen Kontrollverlust hatte praktisch niemand von uns erlebt, das ist für uns unvorstellbar - gewesen. Und das ist, mit bangem Blick auf Italien, nicht mehr so.
Wir sehen auch viele Kleinigkeiten, die uns sonst nie aufgefallen wären, etwa, dass man praktisch keinen Raum verlassen kann, ohne eine Türklinke zu berühren. Wir sehen, wie wichtig für manche von uns diese informellen, losen Begegnungen mit Menschen sind, mit denen wir nicht wirklich eng befreundet sind - und andere sehen vielleicht auch, wie wenig sie diese Begegnungen benötigen. Manchmal denke ich mir, das ist ein ganz interessantes Gesellschaftsexperiment, in dem wir da sind, aus einer Beobachterposition kann man es mit Staunen verfolgen, nur, dass wir in dieser Situation als Menschen die erstaunliche Eigenschaft haben, die Beobachter und die Laborratten zugleich zu sein.