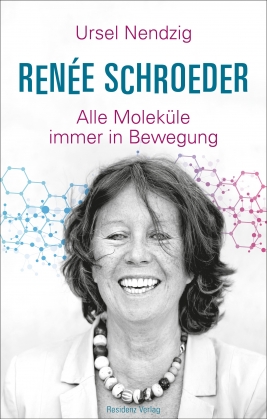Highlights
23. April 2020
Ursel Nendzig, Wien
Videokonferenz
Am Sonntag haben wir drei Geschwister versucht, unsere Eltern zu einem Skype-Meeting zu bewegen. Dann könnten sie die insgesamt sechs Enkerln einmal sehen. Sie wollten nicht. Sie würden ja eh wissen, wie wir ausschauen und auch diese ganze Technik.
Ich war erst überrascht, dann war es mir peinlich, es überhaupt vorgeschlagen zu haben, so spektakulär sehen wir auch wieder nicht aus. Und auch in normalen Zeiten vergehen Wochen, eher Monate, bis wir uns begegnen - zwischen uns liegen 650 Kilometer, viel zu weit, um für ein Wochenende hinzufahren.
Mir geht es überhaupt schon auf die Nerven, Leute auf Bildschirmen zu sehen. Anfangs fand ich das aufregend, vor allem, in die Wohnungen zu spechteln, die man sonst nicht betritt, von Arbeitskolleginnen oder Lehrerinnen der Kinder. Aha, die haben den Ikea-Expedit- Kasten in Holzoptik, wir in weiß. Schau her, die Küche ist aber aufgeräumt und ist das ein Smoothie-Maker? Wie scheußlich darf ein Bild eigentlich werden, bis es niemand mehr über seiner Couch hängen haben will, haha, und noch mehr haha, weil der Mann im Hintergrund hat keine Hose an, voll lustig.
Mich juckt es nicht mehr, wie jemandes Bücherregal, Küche oder Schlafzimmer aussieht. Ich bin so angeödet von Leuten, die in den Bildschirm glotzen, unvorteilhaft von unten beleuchtet sind und gelangweilt nebenher Facebook checken. Es gibt sich ja keiner mehr Mühe. Niemand schminkt sich mehr, nicht einmal frisieren. Die ausgezahrten Leiberln haben sie alle an, eh klar, versteh ich eh, ich geb mir auch nur im Notfall Mühe.
Heute zum Beispiel, da war Zoom-Meeting mit wichtigen Leuten, ich hatte sogar Lippenstift drauf. Mein Mann kam herein und stellte mir (huhu, vielleicht hat ihn ja jemand gesehen in seiner abgewetzten lila Jogginghose!) einen Espresso und ein Salamibrot hin. Aber ich konnte eineinhalb geschlagene Stunden nicht abbeißen davon, weil alles so förmlich war. Irgendwann ging es nicht mehr, die Salami hat so gut gerochen, ich täuschte einen Kamera-Ausfall vor und verschlang das Brot mit drei großen Bissen.
8. April 2020
Ursel Nendzig, Wien
Inzwischen sind die Einladungen völlig unverblümt: „Heute 20 Uhr Zoomsaufen?“ textet meine Freundin.
Vor zwei Wochen haben wir noch so getan, als würden wir uns gesittet über unsere Situationen austauschen, dabei ein, maximal zwei Gläser Wein trinken. Es ist aber nicht so einfach mit dem Online-Trinken. Ich konzentriere mich die ganze Zeit so sehr auf das kleine Bildchen rechts unten, schaue mir selber zu, wie ich trinke, sodass es viel zu schnell viel zu viel wird, ich eine schlechte Internetverbindung vortäuschen und mich aufs Sofa zum Ausrasten legen muss. Dort schlafe ich dann gegen 21:00 ein.
Auch das Ausreden-lassen hat sich schon wieder wegevolviert. Anfangs dachte man: Diese Online-Chat-Situation zwingt uns dazu, die anderen aussprechen zu lassen, weil man sonst gar nichts mehr versteht, und jetzt wird wieder so viel Rücksicht aufeinander genommen. Das halte ich aber mit jedem Glas schlechter aus. Ich schreie also meine Sätze einfach so lange und so laut in den Computer, bis ich auf den anderen Bildern beobachten kann, dass alle aufgegeben haben.
Das wird ein Nachspiel in der echten Welt haben, fürchte ich. Eines Tages.
Apropos echte Welt: Auch hier rauscht die Verbindung schon etwas. Die innerfamiliäre Gesprächskultur hat sich drei Klassen nach unten nivelliert. Auch hier lässt niemand den anderen mehr aussprechen, obwohl eigentlich genug Zeit wäre. Oder noch schlimmer: man beendet die Sätze des anderen, ergänzt um: „Hast du schon dreimal gesagt“. Es scheint, als hätten sich die Stimmen schon abgenutzt, die Kinder sind für meine Frequenz schon völlig abgehärtet. Der Kleine pupst, während wir essen. Ich rolle mit den Augen, aber er täuscht auch eine schlechte Verbindung vor.
Noch zwei Stunden bis Zoomsaufen.
31. März 2020
Ursel Nendzig, Wien
Gerade bekomme ich deutlich vor Augen geführt, dass sich mein Job ganz an der Spitze der Bedürfnispyramide abarbeitet. Niemand braucht Schön-Schreiben, wenn er Angst um sein Leben haben muss, um seine Sicherheit besorgt ist, keine Sozialkontakte haben, noch nicht einmal in ein Kaffeehaus gehen darf. Schönen Gruß von Herrn Maslow: du und deine Arbeit, ihr befriedigt kein Grundbedürfnis.
Dabei ist mein Beruf sonst durchaus anerkannt. Auf Partys, in Mütterrunden, im Freundeskreis - Autorin zu sein war bisher mit das Interessanteste an mir. Ich denke nicht, dass das bei einer hart arbeitenden Altenpflegerin ähnlich gelagert ist. War, meine ich. Weil: Jetzt hat sich die Pyramide auf die Spitze gestellt. Eh zurecht.
Die Sache hat aber noch eine andere Seite und die geht so: Die Kraft, die in den Worten steckt, war noch nie so deutlich wie jetzt.
Schreckliche Kraft, wie etwa im Wort „Großlazarett“ das uns die schirchsten der schirchen Bilder heraufbeschwört. Manipulierende Kraft, wenn Gerüchte verbreitet werden von Plünderungen und Ausgangssperren und Inhaftierungen, die gar nicht stimmen, aber trotzdem: über die Worte haben sie ihr Gift schon verbreitet. Beruhigende Kraft: Wenn man gut recherchierte, auf Fakten ruhende Artikel lesen kann, die einem erklären, welche Konsequenzen welches Verhalten nach sich zieht. Die aufmunternde Kraft, die man selber spürt, wenn man das betagte Pärchen in der Wohnung neben dem Büro anruft – ihr Telefon durch die Wand klingeln hört, man hört dieses Klingeln sonst nie – und ihnen Hilfe anbietet, weil die beiden völlig allein sind. Direkt am Telefon die beängstigend geschwollenen Worte aus einem Schreiben vom Finanzamt für sie übersetzt und ihnen, wieder mit Worten, das Gefühl vermittelt, dass jemand an sie denkt. Und dann ist da auch noch diese erhebende Kraft, die Kraft der Gedichte, der Literatur, der Songs, die uns durch diese Zeit tragen und ihre Wirkung entfalten.
Insofern ist es doch so: diese Pyramide, die besteht nicht aus Schichten, die sich nicht gegenseitig berühren. Es ist viel mehr eine wilde Mischung, alles hängt zusammen. Wer um sein Leben fürchtet, braucht trotzdem die Kraft der schönen Worte. Gerade der.
26. März 2020
Ursel Nendzig, Wien
10 Tage in Isolation, nur wir vier. Die Familiendynamik ändert sich. Die beiden Söhne, neun und sieben Jahre alt, laufen, sich prügelnd, durchs Wohnzimmer. Der Mann und ich schauen zu, über den Rand unserer Teetassen hinweg, es ist ein bisschen wie Kino. Diese beiden sich balgenden Kinder, die abwechselnd und gleichzeitig lachen, weinen und schreien, die wie ein Knäuel zwischen unseren Möbeln durchwirbeln, die gehen uns nichts an. Aber es ist spannend, sie zu beobachten. Hat der Große den Kleinen grade wirklich gebissen? Ja, ich hab es auch gesehen. Schau, obwohl er einen Kopf kleiner ist, kann er ihn im Schwitzkasten halten. Uh, ist das Blut an der einen Backe oder Ketchup? Was ich jedenfalls sagen wollte: könntest du ein Brot einkaufen? Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, es ist Ketchup.
Das war zu Beginn der Isolation anders, in Phase eins.
In Phase eins waren wir, so merkwürdig das klingt, euphorisch. Wir hatten das Gefühl, am Beginn eines Abenteuers zu stehen. Wir würden zuhause bleiben, die Kinder unterrichten. Wir würden Hochbeete bauen und im Kinderzimmer endlich den Schreibtisch aufstellen. Davor würden wir ausmisten. Wir würden so viel Zeit zusammen verbringen, Essenspläne aufstellen und kochen, kochen und kochen. Ganz in Ruhe. Und zusammen sein, reden, Spiele spielen, ach, es würde eigentlich richtig schön werden.
Phase eins dauerte insgesamt zwei Tage.
Am ersten Homeschooling-Tag holte uns Phase zwei ein: Überforderung. Wie sollen wir das alles bitte hinkriegen? Wann werden wir bitte wieder Geld verdienen? Wie schaffen wir das bitte, ohne uns zu zerfleischen? Die mühsam zusammengeschusterte Strategie: sich zusammenreißen, sich an Pläne halten, so viel Normalität wie möglich wahren. Dazu gehört natürlich auch: jeden einzelnen Streit der Kinder zu schlichten.
Diese Phase dauerte wieder zwei Tage.
Aktuell befinden wir uns also in Phase drei, die vermutlich längste Phase dieser Isolation. Sie ist bestimmt von Resignation. Wir können nicht jeden Streit schlichten. Also beschränken wir uns auf jene, die drohen, blutig zu enden. Den Kindern haben wir das auch klar gemacht: Hört zu, wir fahren sicher nicht in ein Krankenhaus mit euch. Erstens, die Ansteckungsgefahr, zweitens ist seit 16 Uhr Schnaps in meinem Tee.
20. März 2020
Ursel Nendzig, Wien
Corona treibt auf die Spitze, was Elternsein heißt. Nämlich: Keine Ahnung zu haben, was zu tun ist. Und trotzdem den Anschein zu erwecken, man habe alles im Griff.
Den Unterricht zuhause abzuhalten, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wie oft brauchen Kinder eine Pause beim Lernen? Wie geht der Trick beim Dividieren durch eine Zweistellige Zahl? Muss man ins Rechenbuch mit Bleistift oder Füllfeder schreiben? Beim Antworten gebe ich mich so sicher, wie ich kann. Nach einer dreiviertel Stunde. Man rundet die Zahlen erst einmal. Bleistift.
Die Quarantäne, auch so schwierig. Ob das was bringen wird? Ob wir das kriegen? Ob die Oma und der Opa daran sterben können? Ob wir sie jetzt an Ostern besuchen dürfen oder nicht? Ich antworte, wieder, so sicher ich kann. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Nein. Aber ich stelle mir selber genau die gleichen Fragen. Vor allem diese: Wie lange wird es dauern?
Das ist die größte Unsicherheit, dieses ungewisse Ende. Neun Wochen Sommerferien sind schon eine Herausforderung, zwei Kinder daheim, zwei Selbstständige, es dauert immer zwei oder drei Wochen, bis sich alles eingespielt hat. Pläne helfen, ganz banale: Tagespläne, wer wann arbeiten darf. Essenspläne. Aktivitäten aufschreiben, die man machen möchte, jede Woche darf einer einen Ausflug aussuchen. Neun Aktivitäten, die Woche Urlaub abgezogen, bleiben acht. Die Woche bei den Großeltern, bleiben sieben. Sieben Essenspläne, sieben Ausflugsziele, sieben Wochen. Das geht.
Aber das hier ist neu: Planen für eine unbekannte Zeit.Sommerferien, da fällt mir ein: auch so eine Sache, die wir für gegeben angenommen haben. Wie Unterrichtsbeginn um acht. Wie Ladenöffnungszeiten. Wie Spielplätze, Fußballplätze, Kindergeburtstage. Diese Situation gerade ist wie eine Erinnerung daran: wir haben uns das alles nur ausgedacht. Wir haben uns diese ganze Konstruktion aus dem Nichts überlegt, fixiert und festgelegt. Und wenn wir es uns wegdenken, ist es auch wieder weg. Alles, woran wir uns so klammern, unsere Routinen, alle weg. Wir stützten uns die ganze Zeit auf ein dünnes, fragiles Geländer.
Es ist ein Impro-Stepptanz, ohne Choreo, dafür mit Hebefiguren. Mal sehen, wie lange unsere Puste hält.